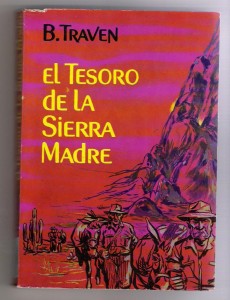Photo by W. Stock
Vor einiger Zeit in der Hotelbar des Vier Jahreszeiten in Starnberg. Eine offene, in dunklem Mobiliar gehaltene einladende Bar mit Tresen, ein schwarzer Flügel in der Ecke zur Fensterfront. Auf einmal sehe ich an der Wand über dem Kaminsims ein riesiges goldgerahmtes Foto des jungen Hemingway.
Warum hängt Hemingway hier, wende ich mich an die junge Barkeeperin. Die Bar heißt so, ist die verblüffend einleuchtende Antwort. Ob sie Hemingway gelesen habe, frage ich. Die Barkeeperin, vielleicht Mitte Zwanzig, kommt aus Dresden und meint, in der DDR habe man Hemingway nicht groß gekannt.
Für einen Augenblick versinke ich in der Vorstellung, was so ein linientreuer Kulturbonze der SED wohl von Ernest Hemingway gehalten haben könnte. Vermutlich hätte er gesagt, wenn er etwas Grips im Hirn gehabt hätte, der Kerl war schon auf der richtigen Seite. Im Spanischen Bürgerkrieg, auf Kuba, nicht aktiv, nicht als militanter Unterstützer, wohl aber intuitiv, aus dem Bauch heraus.
Andererseits war er ein bourgeoiser Lebemensch, der den Genüssen des Lebens zugetan war. Ein Alkoholiker, ein Weiberheld, politisch ein Naivling, also kurz, ein unsicherer Kantonist. Der Mann sei im Grunde genommen unzuverlässig und unberechenbar, hätte der kommunistische Politkommissar wohl in sein Dossier geschrieben, also gefährlich für die Sache des Sozialismus.
Zum Ende meint die ostdeutsche Barkeeperin im Vier Jahreszeiten noch, sie habe auch einen Hemingway Rum. Ob ich den mal sehen könnte, frage ich. Sie holt zwei Flaschen aus der Anrichte hinter ihr. Einen weißen und einen brauen extra viejo. 40 Prozent, Ron Hemingway steht auf der Flasche. Auf dem Etikett prangt ein Foto des bärtigen Literaten. Der 7 Jahre alte Rum hat ein ausgeprägtes, würziges Aroma. Der Ron Hemingway kommt allerdings nicht aus Kuba, sondern aus Kolumbien.
Schade. Denn die kubanischen Genossen haben sich ein entspanntes Verhältnis zum naiven und unsicheren Kantonisten bewahrt. Denn vielleicht zählt am Ende des Tages nicht, ob ein Mensch konservativ oder fortschrittlich, ob er reich oder arm ist. Vielleicht teilen sich die Menschen zu guter Letzt in sympathisch oder unsympathisch. Jedenfalls nach dem dritten Glas Rum.
![]()