Als ich vor einigen Wochen die USA besuchte, schaute ich mir in Baltimore auch die Buchhandlung in der Penn Station an, also den Zeitungsladen im Hauptbahnhof dieser amerikanischen Großstadt. Bumm, Kulturschock!
Ich fand einen winzigen Laden, im Angebot nur zwei Tageszeitungen, die Baltimore Sun und die Washington Post, dazu vielleicht 80 bis 100 Zeitschriften, inhaltlich der gängige Mainstream. Zum Vergleich: Eine gute Bahnhofs-Buchhandlung in einer deutschen Metropole hat auch schon mal 1.000 Titel und mehr im Angebot. Doch Vielfalt in den USA? Nur tote Hose, leider.
Die Medienkrise hat in den Vereinigten Staaten brutaler zugeschlagen als in Europa. Ich habe die sonst so stolze Medienwelt an der Ostküste noch nie so verzagt und so deprimiert erlebt wie in diesen Tagen. Die ganze Printbranche in den USA ist kräftig durchgeschüttelt worden. Die Washington Post, einst ein erhabenes Blatt, ist von der Resterampe weg an Jeff Bezos von Amazon verkauft worden. BusinessWeek, das mit 900.000 verkauften Heften rote Zahlen schrieb, ging an den Großmeister der Börsenterminals, an Michael Bloomberg. Forbes und Fortune, einst die Elite der Wirtschaftsmagazine, dümpeln so vor sich hin.
Das 68 Jahre alte Hochglanz-Magazin Gourmet von Condé Nast wird von heute auf morgen eingestellt – bei 980.000 Abonnenten. Wie – Herrschaftszeiten – kann es kommen, dass solche Zeitschriften kein profitables Geschäft darstellen? Die Krise ist nicht vom Himmel gefallen, die Verleger haben sich zu sehr einlullen lassen in ihrer Komfortzone.
Viele amerikanische Verlage verschenken ihre Monatsmagazine für 10 Dollar im Jahr und leben von Anzeigenerlösen. Nun sind diese Anzeigenetats ins Internet oder TV abgewandert. Bei Condé Nast, das von der Krise besonders arg gebeutelt wird, liegen die Vertriebserlöse im einstelligen Prozentbereich.
Solche Sünden bestraft der liebe Gott irgendwann: Newsweek, das große Nachrichten-Magazin, wird gleich ganz eingestellt. Der Journalismus hat innerhalb weniger Jahre einen harschen Bedeutungsverlust erlitten. Früher – ante crisis – zählte man in dem Land 1,6 Millionen Journalisten, heute sind weniger als 400.000 übrig geblieben.
Einen Chefredakteur, den wir arglos fragen, wie er den Erfolg seiner Zeitschrift messe, antwortet zynisch: Erfolg ist, wenn ich in einem Jahr noch auf diesem Stuhl sitze. How many magazines will close this month?, fragen sich die Medienmanager beim Aufstehen. Wir befinden uns in einer ganz schrecklichen Krise wird gejammert, und in den USA regiert eine Heulsusigkeit als wären wir in Deutschland.
Ist Paid Content die Lösung, wie Rupert Murdoch meint? Nur in der Theorie sagen die Praktiker hinter vorgehaltener Hand. Der Zug ist abgefahren. Es funktioniert nicht gegen die Gratis-Kultur im Internet.
Post crisis werde es nicht besser. So ist die Stimmung, so ist die Lage. Etatkürzungen, das Entlassen von Redakteuren, das Plattmachen von Zeitschriften. Betriebswirte nennen es Strukturwandel und Marktbereinigung. Schon richtig. In der Branche sind grobe Schnitzer passiert und Trends voll verpennt worden. Die Umsätze der Printverlage sind ja nicht weg, sie sind nur woanders. Bei den Cleveren und bei den Smarten.
Es herrscht eine tiefe Resignation bei Amerikas Verlegern, schlimmer noch, eine erbärmliche Ratlosigkeit. Auf die Firmen der Westküste, die den neuen digitalen Medien-Hype anführen, schaut man verächtlich und neidvoll zugleich. Apple, Facebook, Google und Twitter zeigen Verlegern und Journalisten, dass die moderne Welt an ihnen vorbei gezogen ist.
![]()


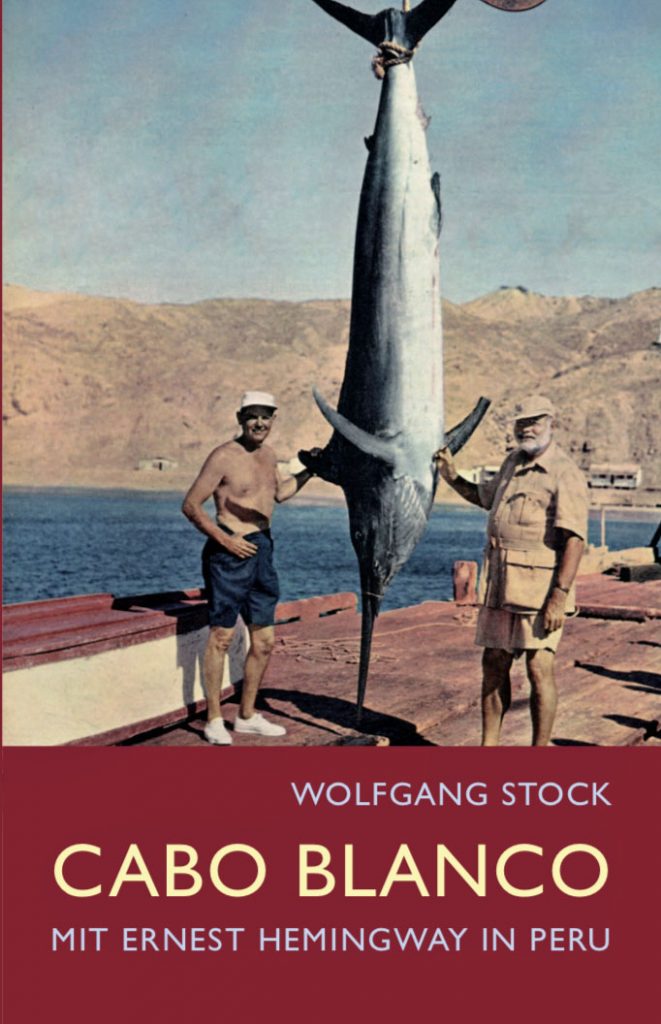
Schreibe einen Kommentar