Anfang November 1959, Fidel Castro, Che Guevara und die anderen Bärtigen sind ein knappes Jahr an der Macht, da kommt Ernest Hemingway aus Europa zurück in seine Wahlheimat Kuba. Bei seiner Ankunft auf Havannas Rancho-Boyeros-Flughafen am 3. November spricht ihn der argentinische Journalist Rodolfo Walsh auf die Horrorgeschichten aus den US-Zeitungen über die Revolution an.
Ärgerlich macht sich der vollbärtige Autor Luft: Schon meine Frau hat gesagt, sie glaubt nicht, was die amerikanischen Zeitungen da schreiben. Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein, weil ich als Kubaner fühle. Ich will nicht, dass ihr in mir einen Yankee seht. Sprach’s, schreitet zu einer kubanischen Flagge und küsst sie.
Daraufhin schlagzeilt am 5. November Havannas Tageszeitung El Mundo stolz: Von seiner Europareise zurück – Hemingway unterstützt die Revolution. Ein J. L. Topping, Botschaftsrat mit schwarzem Schatten, hält nach diesem Vorfall in einem geheimen Hemingway-Dossier des FBI unter dem Datum November 1959 fest:
1. Er unterstützt, sagt er, die Castro-Regierung rundweg und glaubt, sie sei das beste, was Kuba habe zustoßen können.
2. Er habe keiner der auswärtigen Informationen gegen Kuba geglaubt. Er sympathisiere mit der kubanischen Regierung und all unseren (!) kubanischen Schwierigkeiten.
Tennessee Williams, der gern durch Havannas Spelunken zieht, rastlos auf der Suche nach einem Glas Whisky oder einem strammen Burschen oder am bestem nach beidem, ist einer von Hemingways Saufkumpels in Havanna. Hemingway ist es auch gewesen, der den Kollegen – wie Williams in seinen Memoiren ausplaudert – mit Fidel Castro zusammenbringt. Diese Revolution in Kuba ist eine gute Revolution, hat Hemingway dem Dramatiker in gewohnter Präzision und Schärfe mit auf den Weg zu diesem Treffen gegeben. Willie hat genickt.
Auch wenn der scheinbar unverwüstliche Haudegen Hemingway das süße Leben Kubas in vollen Zügen genießt, so verschließt er doch seine Augen vor der sozialen Misere nicht. In seiner knappen Prosa, dem Eisberg-Stil, die nur leichte Konturen und spröde Striche erlaubt, skizziert er auch Armut und Ausbeutung. Schreib einen wahren Satz!, das ist das Credo, das er jungen Journalisten mit auf den Weg gibt, und noch mehr gilt diese Aussage für ihn. In einem Esquire-Artikel bringt Hemingway Ungerechtigkeit und Elend auf eine dialektisch griffige Formel: Das Meer ist sehr reich, der Fischer aber immer arm.
In einem Interview mit Luis Báez erklärt Hemingways Witwe Mary Welsh im September 1977 in der kubanischen Zeitschrift Bohemia: “Als Fidel in Havanna einzog, waren wir ganz auf seiner Seite. Man muss sich ja nur die Regime vor Augen halten, unter denen Kuba bis dahin gelitten hatte. Das waren doch alles Banditen gewesen. Er (Ernest Hemingway) war sicher, dass Fidel Veränderungen zugunsten des Volkes anpacken würde. Er war immer auf Fidels Seite.“
Hemingways Karibikroman Haben und Nichthaben – schon so ein dialektischer Titel – ist im Grunde genommen eine literarische Breitseite gegen die geschmierten Bonzen und Spitzbuben der karibischen Bananenrepubliken, die Politik als Operette geben. Fidel Castro wird sich gegen verteufelt viel Geld durchsetzen müssen, schreibt Hemingway seinem Verleger Charles Scribner nach New York voller böser Ahnung schon im Januar 1959.
Natürlich hat Hemingway, eigentlich ein unpolitischer Mensch, nicht die volle Tragweite der Revolution begreifen können. Aber er sieht Leute wie Fulgencio Batista, den feisten Diktator, und daneben den jungen Rechtsanwalt Fidel Castro. Hemingway weiß dann intuitiv, auf welcher Seite er zu stehen hat. Und seine Unterstützung bleibt nicht nur im Ideelen. Über den befreundeten Bildhauer Fidalgo als Mittelsmann soll Hemingway, munkelt man, Castros Guerilleros in der Sierra Maestra gar einige Pesos zugesteckt haben.
![]()


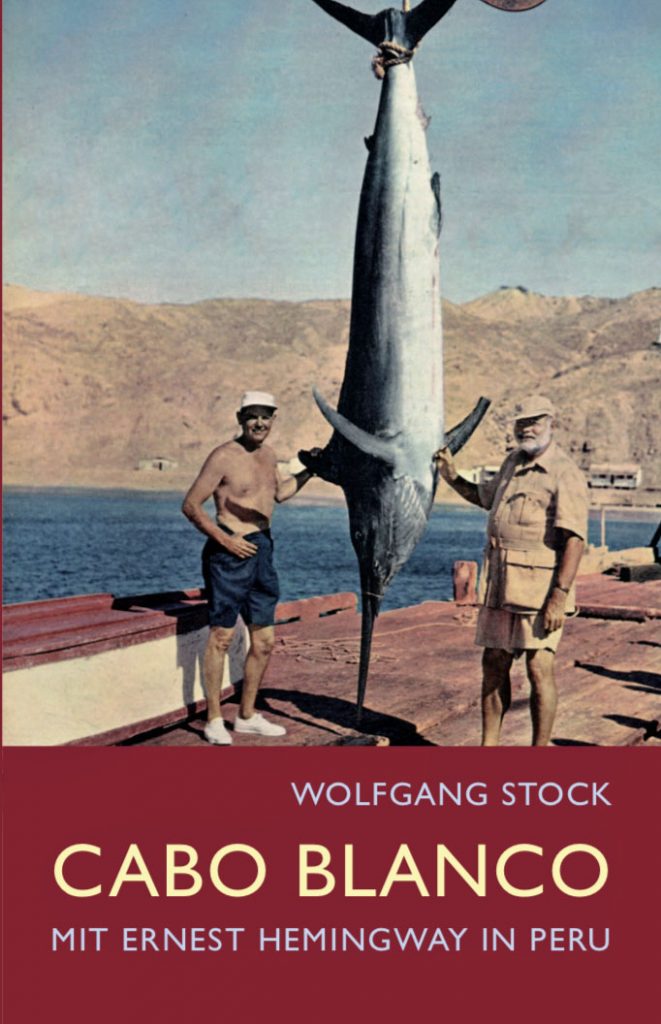
Schreibe einen Kommentar