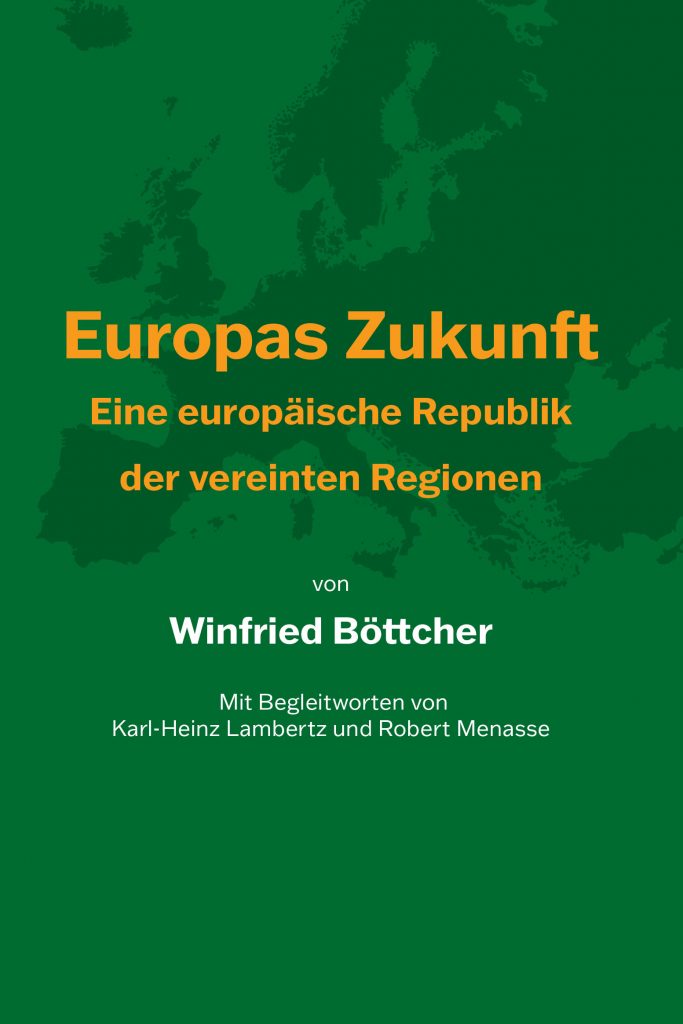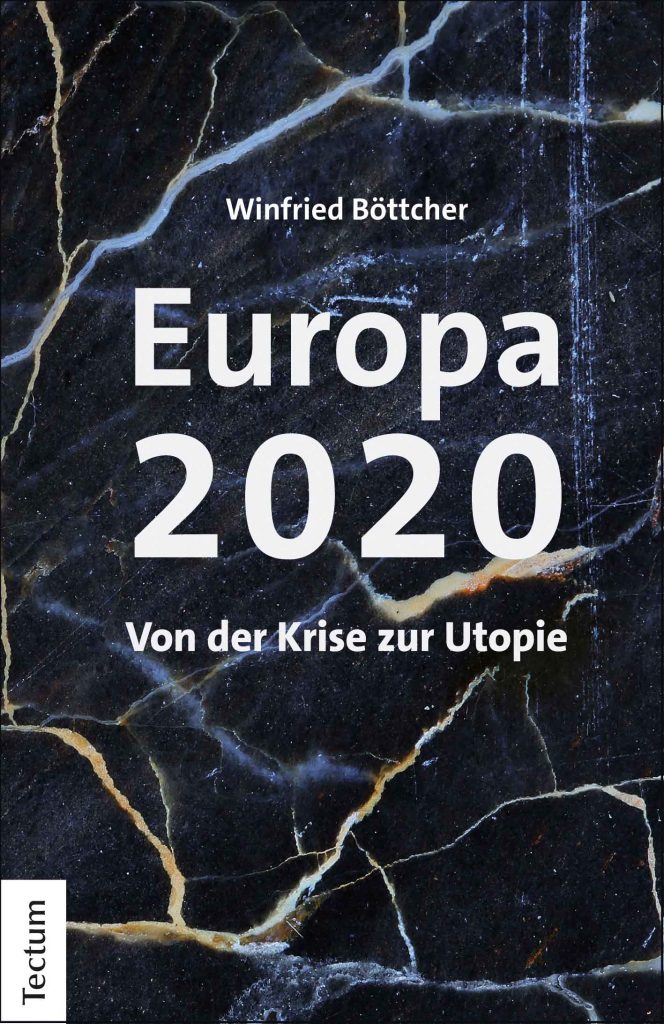Krieg und Frieden. Leo Tolstois Meisterwerk bringt die essentielle Frage der Menschheit prägnant auf den Punkt. Nun leben wir nicht mehr in Zeiten der napoleonischen Kriege des Zarenreiches, sondern 220 Jahre später. Die Brisanz ist geblieben. Unstreitig ist, dass kriegerische Auseinandersetzungen einen wesentlichen Teil der Kulturgeschichte in der Vergangenheit ausgemacht haben, die Gegenwart beherrschen und wohl auch in Zukunft die Menschheit plagen werden.
Winfried Böttcher – Professor emeritus an der RWTH Aachen – befasst sich seit Jahrzehnten mit der Fragestellung, wie Krieg und Frieden Länder und Gesellschaften prägen und verändern. Sein besonderer Blickwinkel gilt dabei der Rolle Europas. Gleich zu Beginn seines neuen Buches erinnert Professor Böttcher daran, dass spätestens nach Entstehung der Nationalstaaten, sich der Nationalismus epidemisch ausgebreitet hat. Der Nationen-Begriff ist historisch und kulturell allerdings komplex. Die Hingabe eines Individuums an die Gemeinschaft ist für die Funktionsfähigkeit eines Staates wichtig, kann aber auch ausgenutzt und missbraucht werden.
Insofern ist es ein missbrauchter Nationalismus, der die eigentliche Ursache für die heutigen Krisenherde ist. Deshalb gilt: Wer den Krieg ausmerzen will, der muss den Nationalismus als Störenfried des Friedens ausschalten. Das Projekt Europa, nach den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, ist in diesem Sinne angelegt worden. Die europäischen Integrationsversuche sieht Böttcher allerdings zwiespältig, mit Erfolgen und Defiziten.
Der Bedeutungsverlust Europas in der Welt ist in der Tat erschreckend. Wenn man als vielgereister Beobachter auf das heutige Europa schaut, wird es einem angst und bange. Strategie und Fokus fehlen völlig. In Peru baut Deutschland Radwege, die Chinesen See- und Flughäfen. Ob es in Gaza Frieden gibt, entscheidet nicht Europas Diplomatie, sondern amerikanische Immobilien-Milliardäre und Katar, Ägypten und die Türkei. Europa – in punkto Wettbewerbsfähigkeit, Ansehen und Erfolg – darf Platz nehmen am Katzentisch des Weltgeschehens.
Vielerorts – von Ungarn bis in die USA – finden sich heute Populisten an den Schalthebeln. Die Sehnsucht nach starker Führung wächst besonders in Krisenzeiten. Europa hingegen ist – bestenfalls – ein wirtschaftlich orientiertes Europa geblieben. Die Idee „Europa“ sei nicht zu Ende gedacht und gebracht, so der Aachener Wissenschaftler. Konkret bietet Winfried Böttcher die Vision eines „Europas der Regionen“ an, mit Bürgerentscheiden als höchster Instanz.
Trotz Krieg und Säbelrasseln ist die Sehnsucht nach Frieden groß. Wie ein besseres Europa aussehen könnte beschreibt Böttcher in Kapitel vier. Er plädiert in Bezug auf die Integration für einen pragmatischen Möglichkeitssinn, um den erstarkenden Nationalismus zu überwinden. Europa kann in der Außen- und Sicherheitspolitik nur auf Geschlossenheit setzen, mit Frankreich und Deutschland als Treiber. „Kriegstüchtig“ zu werden sei ein Irrweg, schüre nur die Angst der Nachbarn und trage nicht zur Befriedung bei.
Ohne „Europafähigkeit“ sieht Böttcher – ein Schüler von Klaus Mehnert – für die Staaten keine Weltfähigkeit. Frieden sei nur dann möglich, wenn er sich weltweit durchsetze. Doch Frieden an sich ist noch kein absoluter Wert. Nur eine Einbettung in humanistische Ideale verleiht ihm Kraft und Beständigkeit.
Vom Verständnis für eine weltbürgerliche Koexistenz hängt der Frieden ab, so Böttcher in seiner anspruchsvollen und detailreichen Abhandlung. Zunächst müsse sich Europa ändern, denn nur die Europafähigkeit mündet in einer Weltfähigkeit. Insofern ist Böttchers Argumentationskette nachvollziehbar. Seine zentrale Botschaft:
![]()