Laberinto/Peru, im Januar 1986
Madre de Dios. Die Mutter Gottes. In Anbetracht eines solchen Namens wäre es pietätlos anzumerken, wir befänden uns am Arsch der Welt. Bleiben wir wohlerzogen. Peruanisches Andentiefland, beginnender Amazonasurwald. Keine Menschenseele weit und breit. Also doch, Arsch der Welt.
Von Madre de Dios, der Provinzhauptstadt, geht es nach Laberinto, ein lausiges Fleckchen aus Schlamm und Morast, wo es keine richtigen Strassen und auch keine Häuser gibt und wo man uns an die Gurgel will, nur weil in unserem Ausweis als Berufsbezeichnung Journalist steht.
Von Laberinto geht es eine Bootsstunde den Fluss hinauf, dann noch einem halbstündigen Fussmarsch durch Dschungeldickicht, bis wir das Lager der Schürfer erreichen. „Da, da hinten im Berg, da ist es drin“, meint Justo Sotelo, ein Veteran unter den Goldsuchern.
Es gebe zwei Möglichkeiten: Entweder entreißen die Sucher das Gold dem Berg, indem sie sprengen, oder sie waschen die Flussufer aus. In diesem Fall werden Flachgebiete, die mit dichter Vegetation bewachsen sind, zunächst brandgerodet, um anschließend die Claims abzustecken. Ein, zwei Monate kann es dann dauern, bis ein Claim vollständig abgetragen ist.
Noch heute wird in Madre de Dios wie vor fünfhundert Jahren Gold geschürft. Eine Gruppe von je vier Männern bearbeitet dabei eine Fläche, die achtmal so groß wie ein Tennisplatz ist. Das Gold wird entweder aus den lehmbraunen Flussbänken oder, was weitaus schwieriger ist, in Niederterrassen aus einer Erdtiefe von vier bis fünf Metern abgebaut.
Der Arbeitsprozess vollzieht sich mit einfachen und schweißtreibenden Hilfsmitteln. Einer der Männer schaufelt mit seinem Spaten die Erd- und Lehmmasse in eine Schubkarre, die ein zweiter Mann anschließend zu einer einfachen Waschanlage karrt. Von einer Wasserpumpe angetrieben, wäscht ein scharfer Wasserstrahl Lehm und Sand aus. Die beiden Mineros an der Stege schleudern Dreck und Lehmpartien zur Seite und waschen den dünnen Sand durch feine Jute- oder Leinensäcke. Der Waschvorgang wird dann mehrmals wiederholt. Und als wir dem Goldwäscher über die Schulter schauen, sehen wir den zarten Goldstaub, der sich aufgrund seiner höheren Dichte von Sand und Gestein ablagert hat.
„Diese Arbeit ist nur etwas für junge, kräftige Burschen“, meint Justo und zeigt seine mit Narben übersäten Beine und die wundgescheuerten Arme. Alle Goldgräber sind bullige Typen und mit einer körperlichen Robustheit ausgestattet, die jeder Muckibude zur Ehre gereicht. Manche sehen aus, wie man sich Piraten aus dem 18. Jahrhundert vorzustellen hat, andere ähneln entlaufenen Sträflingen. Und in der Tat bleibt das Suchen nach dem Gold für viele Haftentlassene eine der wenigen legalen Möglichkeiten, einer halbwegs anständigen Tätigkeit nachzugehen.
Angenehmer als im Knast ist das Leben hier allerdings auch nicht gerade: Die mörderische Hitze der Tropen mit über 40 Grad und die Fressgier der Zancudos und anderer Blutsauger machen den Mineros das Leben schwer. Viele Wäscher sind von der Malaria mit ihren qualvollen Fieberschüben oder anderen grässlichen Tropenkrankheiten befallen. Frauen und Kindern ist der Zugang zu den Goldfeldern nicht erlaubt. Gringos sind eigentlich auch nicht gerne gesehen.
Der Abbau von alluvialem Gold, dem Seifengold, erweist sich meist als reines Glücksspiel. Manchmal fördert eine Person nur zwei Gramm am Tag. Wenn dem Schürfer das Glück hold ist, vielleicht das drei- oder vierfache. Wir buddeln einen Nachmittag mit.
![]()


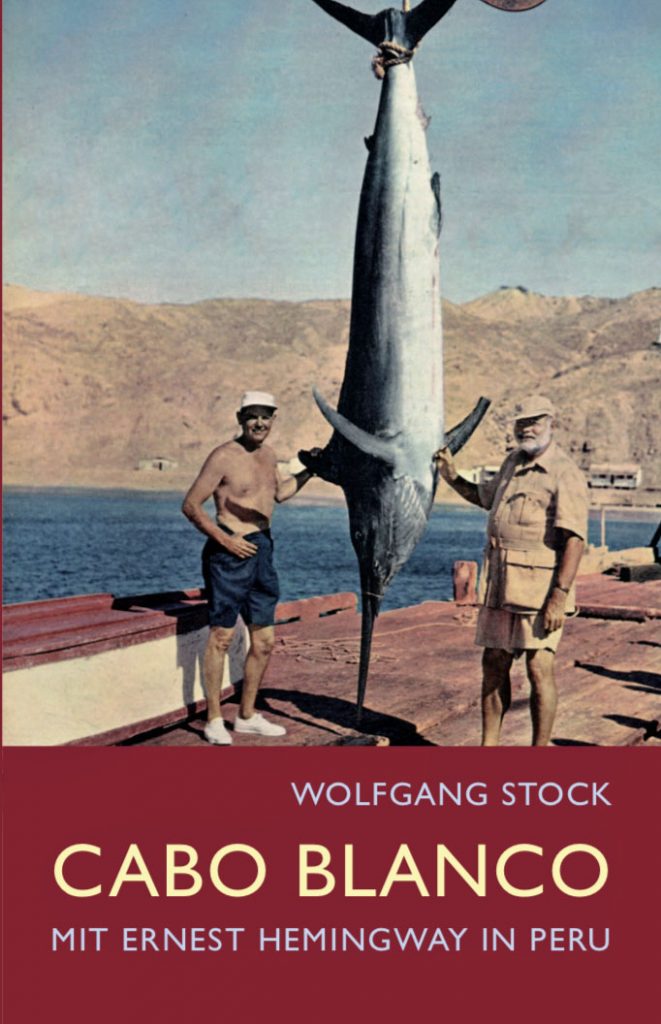
Schreibe einen Kommentar