
Lima, im Dezember 1985; Photo by Norbert Böer
Lima, im Dezember 1985
Lima sei an Hässlichkeit schwer zu überbieten, hat einmal der peruanische Schriftsteller Alfredo Bryce Echenique kund getan. Für dieses Urteil hat er im eigenen Land ziemlich viel Prügel einstecken dürfen. Prügel, die er jedoch mannhaft ertrug, wie ein Caballero, der sich bis in die Hutspitze im Recht wähnt.
Wenn man in Südamerika eine typische Dritte-Welt-Stadt zu benennen hätte, so verkörpert diesen Typus wohl ideal jene blasse Metropole am Pazifik. Dieses Lima mit bettelnden Müttern und klauenden Kindern, mit Vätern, die keine Arbeit finden und saufen gehen, mit Kraterlandschaften, die sich Straßen nennen, diese Stadt mit Wasserhähnen, aus denen häufig eine braune Sauce tröpfelt und mit Menschenschlangen vor katholischen Suppenküchen, die von Jahr zu Jahr länger werden.
Dieses Lima erweist mehr und mehr sich als Stätte des verzweifelten Lebenskampfes bei Tag und der kleinen und großen Gauner bei Nacht. Doch auch hellichten Tag finden hier schlimmste Gaunereien statt. Im Jahr 1968 putschten sich linke Militärs an die Macht, trieben zwölf Jahre ihr Unwesen, und hinterließen ein Land am Rande des Abgrunds und eine Wirtschaft in apokalyptischer Lähmung. Von diesem üblen Intermezzo hat sich die Ökonomie und das Sozialgefüge Perus bis heute nicht erholen können.
Schon die spanischen Kolonisten berichteten von ihrer Mühsal, diesen Ort der dürren Wüste zu ertrotzen und wenn man sich heute nicht gerade in den grünen Vorstädten der Wohlhabenden oder in den Luxushotels aufhält, bleibt stets der Eindruck, über dieser Stadt liege ein staubiger Unsegen oder eine neblige Heimsuchung, die jede Heiterkeit des Lebens im Keime zu ersticken weiß.
Um die Metropole herum haben mittellose Zuwanderer die ausgebleichten Holzhütten und ihre Behausungen aus Blech und Stroh aufgestellt, die sich wie ein riesiges Tuch über die aschgraue Topografie dieser Stadt legen. Lima ist sicherlich keine Liebe auf den ersten Blick und selbst auf den zweiten Blick will sich ihr Reiz nicht so recht entfalten.
Die Stadt erscheint stets verhangen und sogar im Sommer gelingt es der Sonne nicht immer, sich durch den für Lima so typischen dichten Nebelschleier zu boxen. Garúa lautet im peruanischen Spanisch das Wort für diese trübe Suppe. Diese Garúa hängt im peruanischen Winter als eine feuchte und kalte Nebeldecke über Lima. Zwar bringt Garúa milde Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit an diese tropische Küstenwüste, doch wochenlang müssen die Bewohner ohne einen einzigen Sonnenstrahl auskommen.
Das Meer, andern Ortes ein Quell des Lebensmutes und Frohsinns, liegt matt und kalt im fahlen Licht und scheint für die Limeños lediglich eine willkommene Einrichtung, sich kurzerhand ihres Hausmülls zu entledigen. Und auch der liebe Gott meint es nicht gut mit dieser Stadt. Mal lässt er sie von einem Erdbeben mächtig durchrütteln, ein anderes Mal endlose Regenmassen auf sie herunterprasseln – so arg, dass dieser Wüstenfleck im Morast und im Schlamm zu versinken droht.
![]()

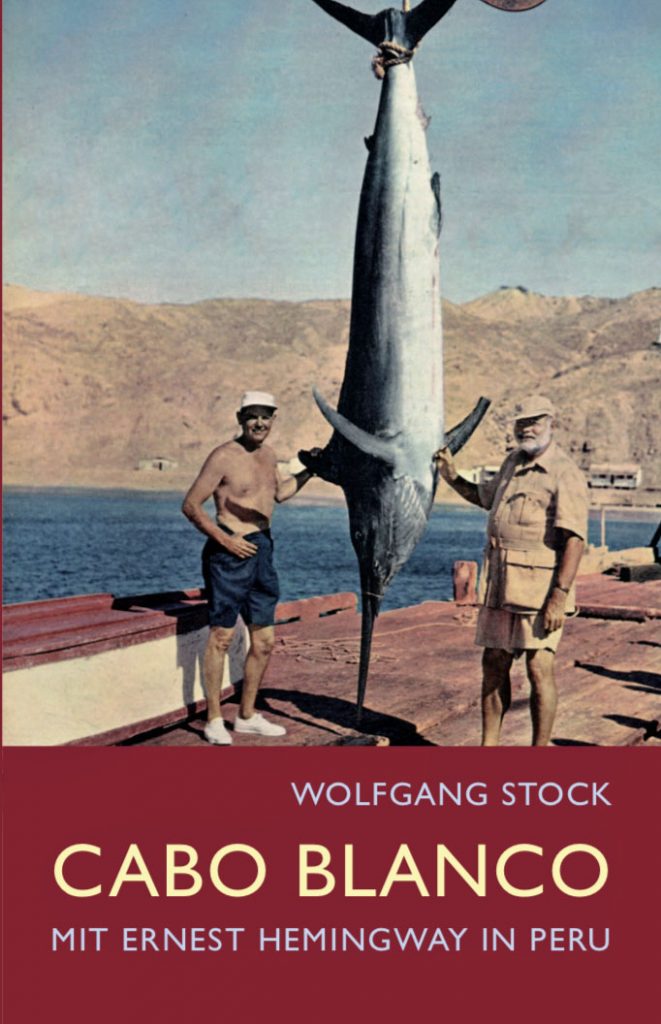
Schreibe einen Kommentar