Schwertfisch auf mediterranem Gemüse. Es mundet. Der Aktien-Altmeister Gottfried Heller besitzt einen wachen Geist und erfreut mit klarer Analyse.
Als elder statesman der Börse sieht er über den Tellerrand und kann die Ereignisse, über die Tagesaktualität hinweg, einordnen. Die köstliche Nachspeise – Aprikosen-Panna Cotta und Himbeer-Sorbet – wird uns fast vermiest durch unser Gesprächsthema.
Stock: Der Euro macht ja seit Jahren große Sorge.
Heller: Der Euro besitzt von Anfang an einen riesigen Konstruktionsfehler.
Stock: Wohl wahr, er ist eigentlich ein politisches Projekt gewesen – und kein wirtschaftliches.
Heller: Schlimmer noch, alle wirtschaftlichen Daten wurden bewußt ignoriert. Man hat hier gänzlich unterschiedliche Kandidaten in ein Korsett gezwängt. Länder, die nicht zusammen passen. Von der Voraussetzung, von der Mentalität, von der Leistungskraft.
Stock: Es wurde ja kräftig geschummelt…
Heller: Wobei zum Schummeln immer
![]()





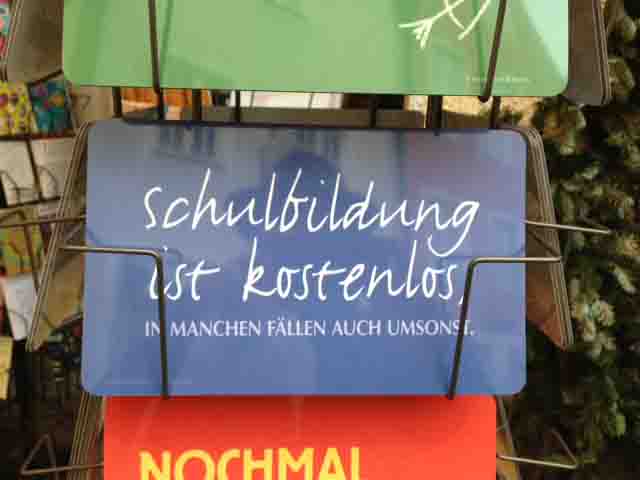


 Immer wieder trifft man auf Anhänger der Arbeitszeitverkürzung. Im Augenblick geistert der aparte Vorschlag von linken Intellektuellen durch die Blätter, man möge die wöchentliche Arbeitszeit auf 30 Stunden für alle reduzieren, das gleiche Gehalt wie für 35 oder 40 Stunden zahlen und alle Probleme dieser Welt hätte man vom Tisch. Die Arbeitslosen wäre in Lohn und Brot, die Produktivität würde steigen.
Immer wieder trifft man auf Anhänger der Arbeitszeitverkürzung. Im Augenblick geistert der aparte Vorschlag von linken Intellektuellen durch die Blätter, man möge die wöchentliche Arbeitszeit auf 30 Stunden für alle reduzieren, das gleiche Gehalt wie für 35 oder 40 Stunden zahlen und alle Probleme dieser Welt hätte man vom Tisch. Die Arbeitslosen wäre in Lohn und Brot, die Produktivität würde steigen.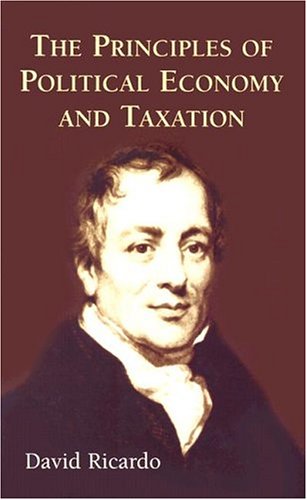 Pilotprodukt des wirtschaftlichen Fortschritts im 20. Jahrhundert war das Automobil. Ermöglichte dieses merkwürdige Vehikel doch, Menschen und Waren von München nach Hamburg in weniger als 10 Stunden zu bewegen. Der Grundstein für Mobilität war gelegt, eine Explosion wirtschaftlichen Wachstums folgte.
Pilotprodukt des wirtschaftlichen Fortschritts im 20. Jahrhundert war das Automobil. Ermöglichte dieses merkwürdige Vehikel doch, Menschen und Waren von München nach Hamburg in weniger als 10 Stunden zu bewegen. Der Grundstein für Mobilität war gelegt, eine Explosion wirtschaftlichen Wachstums folgte.