 Mit schnöseligem „C“. Damit man’s nicht mit dem Oeuvre des bärtigen Karl verwechselt. Die Zeitschrift Capital feiert in diesen Tagen ihren 50. Geburtstag. Den Jüngeren muss man erzählen und den Älteren in Erinnerung rufen, dass diese Zeitschrift aus dem Hause Gruner + Jahr einst an deutschen Kiosken das Glanzstück der Wirtschaftspublizistik war.
Mit schnöseligem „C“. Damit man’s nicht mit dem Oeuvre des bärtigen Karl verwechselt. Die Zeitschrift Capital feiert in diesen Tagen ihren 50. Geburtstag. Den Jüngeren muss man erzählen und den Älteren in Erinnerung rufen, dass diese Zeitschrift aus dem Hause Gruner + Jahr einst an deutschen Kiosken das Glanzstück der Wirtschaftspublizistik war.
In ihren Hochzeiten, so in den 70er und 80er Jahren, verkaufte man schon mal locker 300.000 Exemplare und inhaltlich war das Monatsheft vom Allerfeinsten. Die Rolex unter den Magazinen, wenn man so will. Ein bißchen großspurig vielleicht, aber im Grunde doch ziemlich nobel.
Der Markenkern der Zeitschrift war beim Lesen der exquisiten Stücke wie Parfümduft zwischen all der Druckerschwärze gut zu erriechen. Elitär, immer ein Stück über den Dingen schwebend, mit der nötigen Distanz, die feine Ironie des Überlegenen hier und da spürbar – das war Capital in einem guten Monat. Und davon gab es genug.
Nun feiert sich das Heft selbst, und beim Lesen der Geburtstagsstrecke wird man das Gefühl nicht los, Capital scheine nach einem halben Jahrhundert seinen eigenen Abgesang anzustimmen. Denn so trocken und leblos wurde selten ein 50. Geburtstag gefeiert.
Da werden pflichtbewusst ein paar alte Cover abgebildet, ein paar Zitate gestreut, da werden vergilbte Seiten angerissen und die Themen jener Zeit kurz berührt. Aber die großen Männer, die das Magazin über die Jahre prägten, die muss man mit der Lupe suchen: Adolf Theobald, den Gründer des Magazins, Ferdinand Simoneit, den langjährigen Chefredakteur, Rolf Prudent, den redaktionellen Majordomus, Ralf-Dieter Brunowsky, den jungen Wilden.
Und vor allem werden zwei Menschen nicht gewürdigt, die dem Magazin Gesicht, Esprit und Seele gaben. Johannes Gross, Chefredakteur und später Herausgeber. Und André Kostolany, der beste Kolumnist von allen. So gut wie nichts zu finden von den beiden, so als habe es sie allenfalls als amüsante Fussnote gegeben. Unverzeihlich und obendrein peinlich, ein Armutszeugnis für diese Zeitschrift, die seit Jahren ein Schattendasein guter Tage fristet.
Man möchte den Kollegen in Hamburg zurufen: Ohne Tradition keine Zukunft. Es scheint, als sei der Zeitschrift in schwierigen Zeiten ihre Seele abhanden gekommen. Als schäme man sich ob der glorreichen Vergangenheit, weil man der Zukunft nicht so recht über den Weg traut. All das schöne Selbstbewußtsein guter Tage, weg und perdu.
All das macht einen nicht gerade frohgemut. Beim Blättern der aktuellen Ausgabe setzt sich die Tristesse fort. Nichts von Belang und Güte, nur Trostlosigkeit und Trübsal, die am Ende einer großen Tradition übrig bleiben. Ja, man muss es so deutlich aussprechen: Capital, es fehlt der Sinn. In jeder Beziehung.
![]()

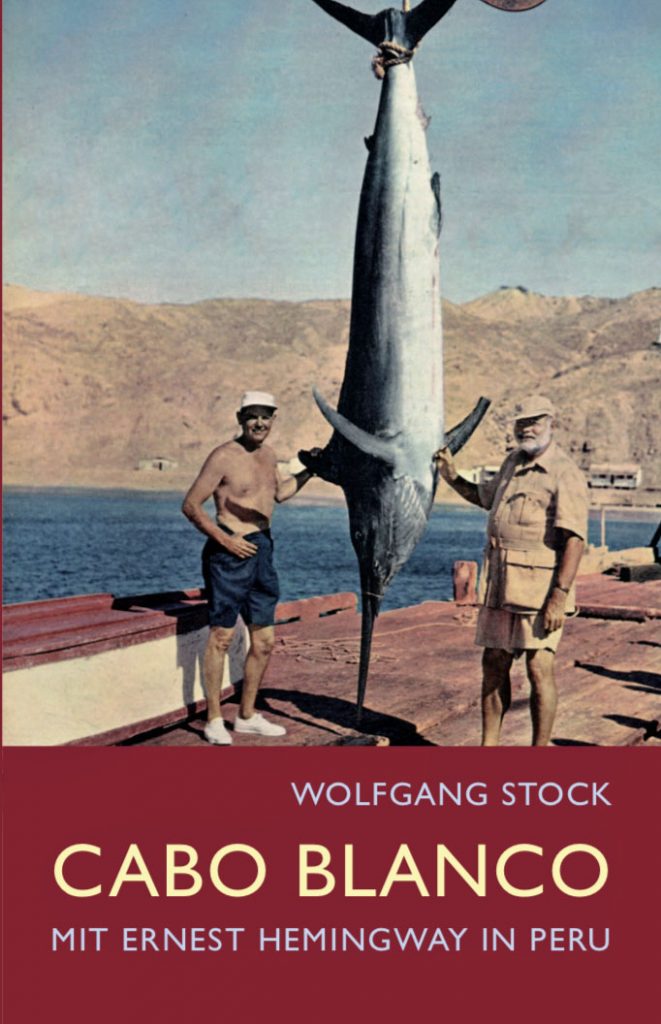
Schreibe einen Kommentar