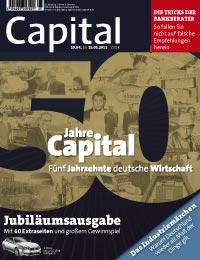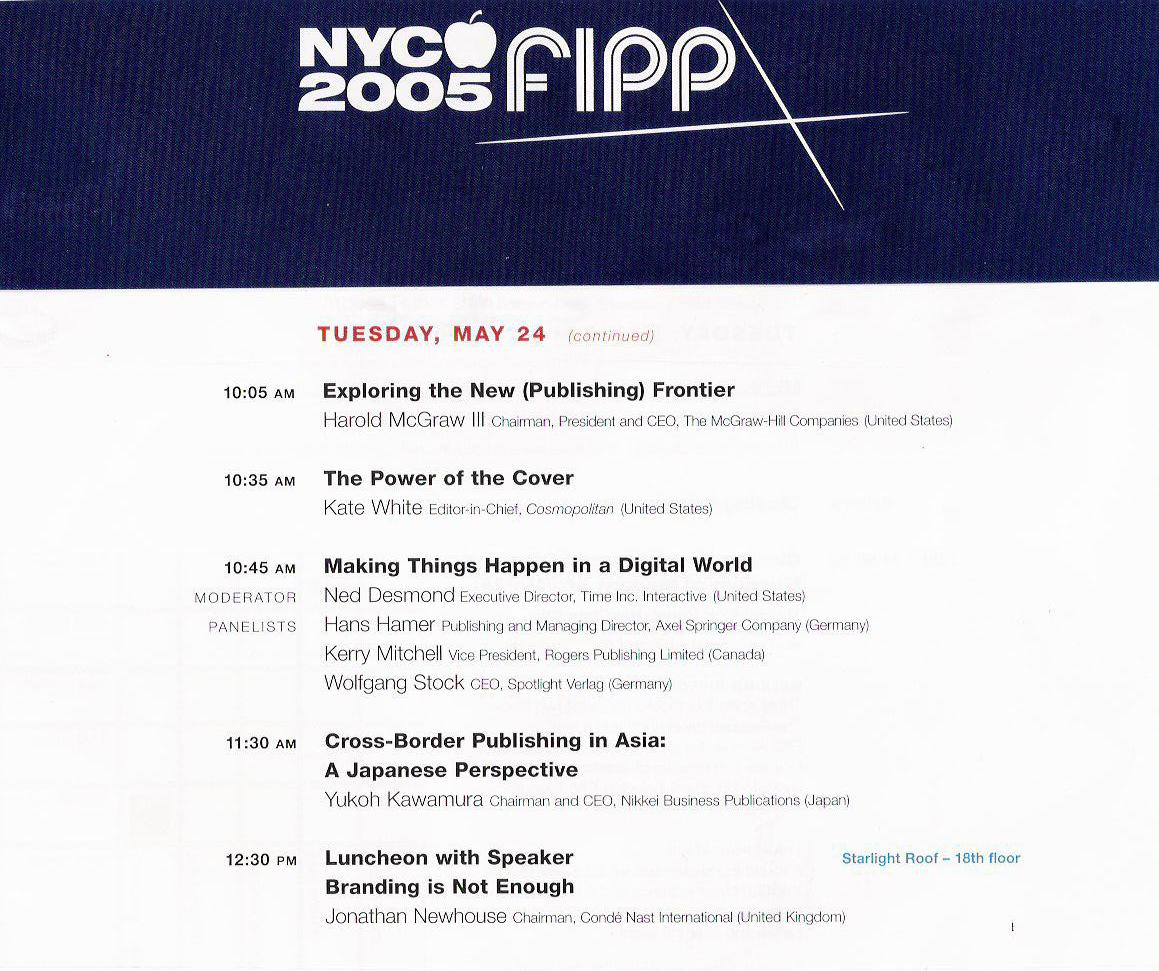Die Franzosen haben das Renteneintrittsalter gerade auf 60 Jahre herunter gesetzt. Und auch hierzulande tut man sich immer noch schwer mit der Rente mit 67, die SPD-Minister Franz Müntefering vor ein paar Jahren eingeführt hat.
Die Franzosen haben das Renteneintrittsalter gerade auf 60 Jahre herunter gesetzt. Und auch hierzulande tut man sich immer noch schwer mit der Rente mit 67, die SPD-Minister Franz Müntefering vor ein paar Jahren eingeführt hat.
Dabei ist die Sache doch ziemlich einfach. Denn je länger die Lebenserwartung der Menschen wird, desto später muss selbstverständlich der Rentenbeginn liegen, um die Produktivkraft zu nutzen und das Rentensystem nicht zu überfordern.
Trotzdem trauern viele der Rente mit 65 oder gar 63 Jahren nach. Aber wenn ich es mir recht überlege, dann ist die Rente mit 63 in der nostalgischen Logik zu kurz gesprungen. Ich möchte mich in diesen Zeilen für die „Rente mit 50“ starkmachen.
Die Finanzierung der Rente mit 50 folgt jener hübschen Argumentation der Nostalgiker. Finanzierung? Kein Problem. Denn es gäbe
![]()