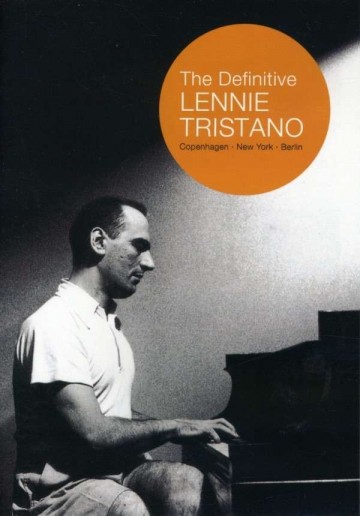Besonders bei Live-Konzerten setzte Frank Sinatra Come fly with me gerne ein, oft auch als opening theme. Jimmy Van Heusen hatte Come fly with me 1957 komponiert und die Textzeilen dichtete der Spassvogel Sammy Cahn. Das Lied war eigens für Sinatra von den beiden geschrieben worden und schnell gehörte der Song zu Frankieboys Standardrepertoire.
Ein Album von Frank Sinatra aus dem Jahr 1958 trug den gleichen Namen. Es war die erste Zusammenarbeit mit dem Arrangeur und Bandleader Billy May. Die Schallplatte dreht sich um eine Weltreise, von Paris über New York bis nach Capri. Aber der Hauptsong Come fly with me bleibt das swingende Herzstück der Platte.
Weather-wise it’s such a lovely day
You just say the words and we’ll beat the birds
Down to Acapulco Bay
It’s perfect for a flying honeymoon, they do say
Come fly with me, let’s fly, let’s fly. let’s fly away
Come fly with me gibt dieser Sinatra-Platte das Motto vor. Around the world with music. Für mich besitzt der Song seit jeher eine besondere Bedeutung. Wie der Zufall so will, ich trieb mich in jungen Jahren an der Acapulco Bay herum. Wunderbare Erinnerungen.
Später gab es dann noch eine Duett-Version – übrigens virtuell – mit dem mexikanischen Sänger Luis Miguel von Come fly with me, das war im Jahr 1994, und Franks Stimme war schon brüchig. Aber trotzdem sah dieser Milchmann Luis Miguel gegen unseren Sinatra alt aus, verdammt alt.
Auf Frank Sinatras zierlichen, in den Boden gefassten Grabstein im südkalifornischen Cathedral City steht: THE BEST IS YET TO COME. Das Beste kommt erst noch.
Zwölf Jahre ist Frank Sinatra nun schon tot. Blödsinn, er ist nicht tot, er ist vor 12 Jahren nur gestorben. Irgendwie ist Ol’ Blue Eyes noch immer unter uns. Erheben wir ihm zu Ehren ein Glas Jack Daniels und stossen mit ihm an. Frankieboy, alter Schlawiner, ein Kerl wie du ist einfach nicht klein zu kriegen.
![]()