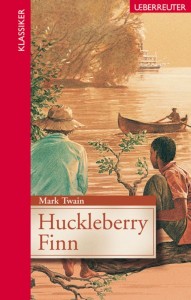Unter konspirativen Umständen, man kann es nicht anders sagen, kam ich zu Günter Wallraff. Denn Wallraff musste für ein paar Wochen von der Bildfläche verschwinden.
Ich traf Günter Wallraff im Sommer 1979. Er hatte über drei Monate unerkannt in der BILD-Lokalredaktion in Hannover gearbeitet und enthüllt, mit welchen Methoden Deutschlands führende Zeitung zu arbeiten pflegt. Sein Buch Der Aufmacher – Der Mann, der bei ‘Bild’ Hans Esser war erklomm rasch die Bestsellerlisten und wurde heftig diskutiert.
Neben reichlich Lob und Bewunderung über diesen Scoop hagelte es Widerspruch, Klagen, Drohungen und Wallraff zog sich für einige Tage in das Haus eines Freundes zurück, weit ab der Großstadt und der medialen Aufmerksamkeit.
Seine Assistentin lotste uns per Telefon wie in einem Krininalfilm zu seinem geheimen Refugium. “Fahren Sie nach Bergisch-Gladbach, dann Richtung Kleinkleckersdorf, auf halbem Weg sehen Sie eine hohe Eiche, biegen Sie dort in den Waldweg…” Und so weiter, und so fort. Man kam sich vor, wie in einem Thriller von John le Carré. Wir waren, zumindest für einen Tag, Teil des System Günter Wallraff geworden.
In dem Sommerhaus im Bergischen empfing uns Wallraff freundlich, neugierig und doch stets auf der Hut. Er war eigentlich immer auf der Lauer, und manchmal wusste man nicht so recht, ob man nun Günter Wallraff oder doch Hans Esser vor sich hatte.
Ich mag Wallraffs subjektive Annäherung an das Schreiben. Das hat eine lange Tradition, denn schon Upton Sinclair hatte 1905 mit The Jungle einen inkognito recherchierten Roman veröffentlicht, der die Zustände in den Schlachthäusern von Chicago anprangerte. Muckraker, nennen die Amerikaner diese Form des Journalismus verächtlich, Schmutzwühler, Nestbeschmutzer. Bisweilen hört es sich wie eine Auszeichnung an.
Und Muckraker Wallraff enthüllte Mißstände wie kein anderer: Er war der Türke Ali bei Thyssen und – mein Liebling – er deckte Putschpläne und Waffenschiebereien des sinistren früheren portugiesischen Staatspräsidenten General António de Spinola auf. Manchmal vernahm man eine übermütige Spöttelei in seiner Recherche. Beispielsweise, wenn er sich bei Gerling auf den Chefschreibtisch breit machte.
In der schwedischen Sprache hat sich der Begriff wallraffa eingebürgert, das Verb bezeichnet einen verdeckten Recherchestil. Wallraff hat den Journalismus um eine Dimension bereichert. Überraschend angreifen, unerkannt beobachten, ganz nah rangehen. Das ist zwangsläufig höchst subjektiv und nicht mehr objektiv. So what? Das ist jedenfalls aufregender und spannender als das meiste Zeug, das die Sesselpupser so schreiben.
![]()