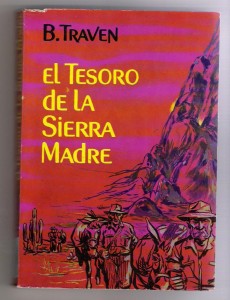Cojímar/Kuba, im April 1983
Wer sich denn in Sachen Hemingway am besten auskenne, frage ich den Wirt der Hafenkneipe in Cojimar, nachdem ich den Teller Linsen, das einzige Gericht des Lokals, aufgegessen habe. Hemingway?, hebt dieser fragend die Augenbraue. Don Ernesto, sage ich. Ja, sagt der korpulente Wirt, dann gehen Sie am besten zu Gregorio, der wohnt oben im Dorf.
Ich gehe zu Gregorio. In Sachen Hemingway ist Gregorio Fuentes in der Tat die beste Adresse in Cojímar. Der rüstige Gregorio wohnt mit seiner Frau in einem kleinen, blaugestrichnene Häuschen oberhalb der Dorfstraße. Den Gallego, den Galizier, nennen sie Gregorio in Cojímar, weil seine Vorfahren aus dem nordspanischen Galizien stammen. Übrigens wie Fidel Castros Vater, der aus Lugo eingewandert ist.
Gregorio Fuentes trägt eine einfache Leinenhose und ein weißes Guayabera-Hemd, das man nicht in die Hose zu stecken braucht. Gregorio ist in Cojímar eine Berühmtheit. Von 1938 bis zu Hemingways Tod war er der Kapitän der Pilar. Eigens für den Schriftsteller war das Motorboot 1936 gebaut worden, und oft fuhren die drei – Gregorio, Hemingway und Ehefrau Mary Welsh – zur Fischjagd in den Golfstrom.
Der hagere Gregorio nannte seinen berühmten Chef Papa, wie alle Freunde, er ihn jovial Viejo, meinen Alter. Und nun hat er, der Viejo, seinen Papa, der sogar ganze elf Tage jünger war, schon Jahrzehnte überlebt. Die Fischer aus Hemingways Romanen tragen unverkennbare Züge von Gregorio und Carlos Guttiérez, dem ersten Kapitän der Pilar. Gregorio ist der Antonio in Inseln im Strom, und in The Great Blue River lässt Hemingway seinen Gregorio, als ein kapitaler Fang an der Leine zappelt, in dessen breitem kubanischen Akzent brüllen: Feesh, Papa, feesh.
Gregorio erinnert sich. „Eigentlich kannte ich Papa schon seit 1931. Später holte er mich als seinen Kapitän“, sagt der wettergegerbte Gregorio, dem seine Havanna ins Gesicht gewachsen zu sein scheint. „Morgens um acht ging es raus, bei Einbruch der Dunkelheit zurück. Oft drei Tage hintereinander. Das brauchte er. Um seine Gedanken freizumachen.“
Auf einer dieser Angeltouren, da trafen sie auf ein Boot mit einem alten Mann und einem Kind, beide aus Pinar del Rio, die schon tagelang nichts mehr gefangen hatten. Papa machte sich ein paar Notizen in sein Moleskine-Büchlein. Dann schrieb er auf der Finca Vigía das Buch. So einfach war das.
Gregorio kramt aus seiner Schublade einige vergilbte Fotos. Sie zeigen ihn und Hemingway auf dem Boot, im Hafen. Wie war Hemingways Charakter, frage ich, sprunghaft? „Überhaupt nicht. Immer fröhlich, immer geradeaus. Der Kopfschuss aber hat mich nicht überrascht. Er war sehr schlecht dran. Ich auch“, sagt Gregorio, während er auf seiner La Gloria Cubana herumkaut.
„Es waren die Tage der Söldnerinvasion in der Schweinebucht.“ Eine schreckliche Zeit. Und einige Wochen nach Papas Tod sei der Comandante persönlich hier nach Cojímar in sein Haus gekommen und Fidel Castro habe ihm befohlen, Gregorio, jetzt musst du auf die Pilar acht geben. Er habe sie wie einen Schatz gehütet, bis sie dann damals im Museum gelandet sei.
Als wir uns von Gregorio verabschieden wollen, packt mich der Greis mit festem Griff am Handgelenk. „Hemingway war gut zu Kuba, sag das deinen Lesern.“ Ich gehe nochmals zum Wirt in die Hafenkneipe, kaufe ein paar Zigarren und bringe sie dem alten Gregorio vorbei.
Gregorio Fuentes ist im Januar 2002 gestorben, im Alter von 104 Jahren. Der alte Mann und das Meer hat er nie gelesen.
Bitte besuchen Sie zum Thema Ernest Hemingway mein neues Blog Hemingways Welt.
![]()